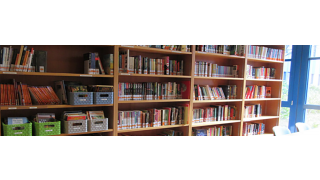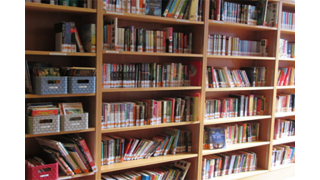Bildquelle: Bundesministerium für Bildung
Mit dem Lesegütesiegel zu mehr Lesekompetenz
Im Schuljahr 2024/25 konnten Österreichs Volksschulen erstmals das Lesegütesiegel erwerben. Das bundesweite Gütesiegel „Lesen. Deine Superkraft“ zeichnet Schulen aus, die mit besonderem Engagement und einer Vielfalt von Maßnahmen die Lesekompetenz und Lesemotivation ihrer Schüler*innen fördern. Die Schulbibliothek kann dabei als zentraler Ort des Lesens und der Leseförderung wichtige Beiträge liefern.
Bereits durch die Auseinandersetzung mit den Kriterien zur Erlangung des Lesegütesiegels erhalten Schulen eine Fülle an Anregungen, wie sie die Lesekompetenz der Schüler*innen wirksam und nachhaltig stärken können. Die fünf Schwerpunkte des Kriterienkatalogs für Volksschulen weisen sowohl verpflichtende als auch ergänzende Kriterien aus, die u. a. die Bedeutung der Schulbibliothek in diesem Zusammenhang verdeutlichen.
Die 5 Schwerpunkte des Kriterienkatalogs
- Schulische Lesekultur
- Leseräume
- Diagnosebasierte Leseförderung
- Leseanimation
- Literarische Bildung
Mehr zu den Schwerpunkten lesen Sie auf literacy.at.
Die Schwerpunkte im Licht bibliothekarischer Arbeit
Betrachtet man die Rolle der Schulbibliothek sowie ihre Aufgaben und Funktionen, so wird schnell deutlich, dass die Einbindung einer professionell geführten Bibliothek in das gesamtschulische Leseförderkonzept ein großer Gewinn für Schüler*innen wie auch deren Lehrpersonen ist und wesentlich zum Erwerb des Lesegütesiegels beitragen kann.
Lesekultur braucht Leseräume
Schulische Lesekultur baut darauf auf, dass alle Pädagog*innen am Standort gemeinsam eine Vision und damit verbundene Zielsetzungen zur Stärkung der Lesekompetenzen bei Schüler*innen entwickeln. Der kompetente, überfachliche Blick ausgebildeter Schulbibliothekar*innen auf das schulische Leseförderkonzept kann wertvolle Impulse bei der Entwicklung schulspezifischer Maßnahmenpakete liefern.
Ziel der Lesekultur ist es, Lesen im gesamten Schulgebäude sichtbar zu machen. Geeignete Leseräume sind dabei ebenso entscheidend wie positive Leseerlebnisse im Schulalltag. Eine professionell geführte Schulbibliothek mit einem attraktiven Angebot an Lesestoff, verbunden mit zielgerichteten Aktivitäten zur Leseförderung und Leseanimation, bildet ein solides Fundament für die Etablierung einer schulischen Lesekultur.
Bibliotheken unterstützen die Schülerinnen und Schüler in der Entwicklung ihrer Lesekompetenz in allen Sprachen und bieten vielfältige Angebote im Bereich der Lese- und Sprachförderung sowie der Lesemotivation. Zudem leisten Schulbibliotheken einen wertvollen Beitrag zur Chancengleichheit. Ausgebildete Schulbibliothekar*innen sind ein wesentlicher Bestandteil für die Entwicklung der Lesekultur an der Schule.
[vgl.: Bundesweites Lesegütesiegel – „Lesen. Deine Superkraft“ Kriterienkatalog für Volksschulen Grundlage für die Einreichung im Schuljahr 2024/25, BMBWF, Wien 2024, S.9]
Kann eine Kleinstschule nicht die nötigen Ressourcen für eine eigene Schulbibliothek aufbringen, bildet die Zusammenarbeit mit einer öffentlichen Bibliothek eine bewährte Alternative. Für Kooperationen mit öffentlichen Bibliotheken oder anderen, dem Lesen gewidmeten, Organisationen (z.B. Buch.Zeit, Buchklub, Institut für Kinder- und Jugendliteratur, Lesen in Tirol, Lesezentrum Steiermark, STUBE, Zeit Punkt Lesen NÖ), stellen ausgebildete Schulbibliothekar*innen ein wichtiges Bindeglied dar. Sie kennen die regionalen Partner, koordinieren die Angebote und fördern den Austausch und die Zusammenarbeit aller am Leseprozess beteiligten Personen.

Vom Leseraum zum Leseförderraum
Durch die strategische Einbindung der Schulbibliothek in das Leseförderkonzept der Schule wird die Bibliothek zu einem Motor für Lesemotivation, Leseanimation, Medienkompetenz und literarische Bildung. Schulbibliothekar*innen können für eine kontinuierliche, professionelle Betreuung von diversen Lesethemen und Leseaktivitäten am Schulstandort sorgen. Wichtig dabei ist eine entsprechende Vor- und Nachbereitung der Aktivitäten und Leseanimationen. Folgende im Kriterienkatalog explizit angeführten Aktivitäten eignen sich besonders für die bibliothekarische Arbeit:
- Organisation von regelmäßigen Vorlesezeiten unter Nutzung der Bestände der Schulbibliothek
- Beteiligung am Vorlesetag
- Organisation von Begegnungen mit Autor*innen
- Einbindung von Lesevorbildern und Lesebotschafter*innen (inkl. Aufnahme der vorgelesenen Werke in den Bestand der Schulbibliothek)
- Vorstellung und Bewerbung aktueller Buchempfehlungen in der Bibliothek
- Einbindung von Schüler*innen in den Bibliotheksalltag (Erstellen von Leseempfehlungen, Beratung bei Lektüreankauf, Unterstützung im Verleih, Aufbereiten themenspezifischer Büchertische etc.)
- Integration multimodaler Angebote (Leseapps, Hörbücher, Literaturverfilmungen, Comics etc.) zur Steigerung der Lesemotivation
- Präsentation der Ergebnisse von produkt- bzw. handlungsorientierten Leseaufgaben (Leserolle, Bücherboxen, Lapbooks etc.)
- Bereitstellung mehrsprachiger Medien
Abgesehen von den Aktivitäten zur Leseanimation und zur literarischen Bildung, die die Schulbibliothek anbieten kann, unterstützt das Medienangebot der Bibliothek die individuelle Auswahl des Lesestoffs. Schüler*innen können in der Bibliothek selbst entscheiden, welche Bücher sie gerne lesen wollen, wodurch die Lesemotivation deutlich gestärkt wird. Persönliche Leseinteressen spielen bei der Wahl der passenden Lektüre ebenso eine wichtige Rolle wie die Berücksichtigung der Lesefertigkeit. Geschulte Schulbibliothekar*innen beraten Schüler*innen kompetent bei der Wahl ihres Lesestoffs. Die Schulbibliothek kann somit räumlich, organisatorisch, didaktisch und personell zur Steigerung der Lesekompetenz beitragen und stellt einen wesentlichen Baustein für den Erwerb des Lesegütesiegels dar.
Praktische Tipps zur Förderung der Lesekompetenz finden Pädagoginnen und Pädagogen auf literacy.at. Fertige Unterrichtspakete inklusive Ankaufsempfehlungen für die Schulbibliothek liefern die BibTipps! im Portal Schulbibliotheken Österreich.
Das bundesweite Lesegütesiegel für Volksschulen wurde im Auftrag des Bildungsministeriums in enger Zusammenarbeit mit den Bildungsdirektionen und unter breiter Einbindung weiterer Leseexpert*innen verschiedener Institutionen entwickelt. Die Ausweitung des bundesweiten Lesegütesiegels auf andere Schularten folgt.